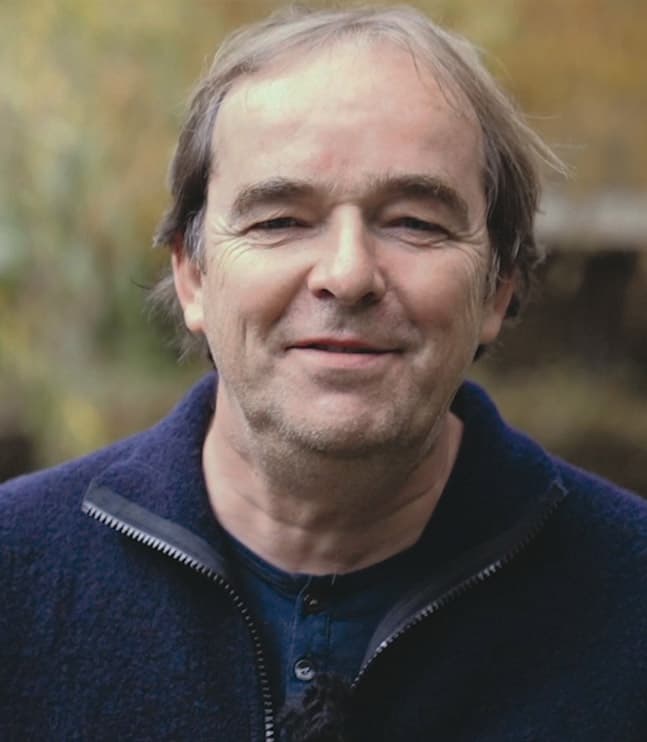Eine Frage, die mich oft bei deinen Youtube-Videos beschäftigt hat, ist, was du
eigentlich darüber weißt, wann Menschen nach Argumenten suchen? Wann will jemand
etwas wissen? Er will etwas wissen, wenn er sich entscheiden muss: Impfen oder
nicht Impfen. Er will aber auch seine Entscheidung rechtfertigen, die er trifft,
wenn er einen Diesel fährt, wenn es ein Fahrverbot gibt und er dennoch in die Stadt
fahren will. Er braucht Argumente gegenüber anderen, und dann will ich andere überzeugen
von dem, wovon ich überzeugt bin. Das sind drei Kernmotive. Wenn du dein Publikum
imaginierst, kannst du dazu etwas sagen, was suchen die genau in deinen Videos?
Ich würde gerne zumindest noch eine Gruppe hinzufügen zu dem, was du gesagt hast,
nämlich Menschen, die ein bisschen frustriert darüber sind, dass du, wenn du heute
den Fernseher anmachst oder die Zeitungen liest oder irgendetwas googelst, dich
selbst informieren möchtest, dass du immer widersprüchliche Infos findest und du
immer das Gefühl hast, die eine sagt das und der andere sagt das und jetzt weiß
ich auch nicht. Es gibt das Bedürfnis, es genauer zu wissen oder zumindest mehr
Details zu erfahren, um in der Lage zu sein, eine eigene Meinung zu bilden und
nicht in so einer ohnmächtigen Position zu sein, dass ich entscheiden muss, vertraue
ich blind dieser oder jener Person. Da habe ich den subjektiven Eindruck, wenn ich
die Kommentare lese, dass viele sehr dankbar sind, dass wir uns immer so viel mit
Methoden aufhalten. Gerade, wenn es um Bewegtbild geht, kommt Wissenschaftsvermittlung
oft zu kurz. Da spricht man immer nur über Ergebnisse und wir schauen immer, dass wir
erst mal Grundlagen, aber auch Methoden erklären, damit man nicht nur hören muss, der
Wirkstoff ist so und so viel Prozent wirksam, sondern was bedeutet diese Zahl, wie
wurde sie ermittelt und dann kann man auch als Laie nachvollziehen, wo die Grenzen
von einer Methode sind, woher Unsicherheiten kommen und so weiter. Ich denke, dass
viele an irgendeinem Punkt in ihrem Leben, wenn sie sich eine Meinung bilden, an
einem sehr offenen Punkt sind. Und ich denke auch, dass man, wenn man erst einmal
einen bestimmten Weg gegangen ist, mit Confirmation Bias und so weiter, nicht mehr
so leicht davon abrückt. Und dann ist das ein Kampf gegen Windmühlen. Aber so sehe
ich meine Arbeit nicht, ich sehe das wirklich optimistischer. Ich glaube schon,
dass ich viele Menschen erreichen kann, die ganz aufrichtig einfach nach mehr
Infos suchen.