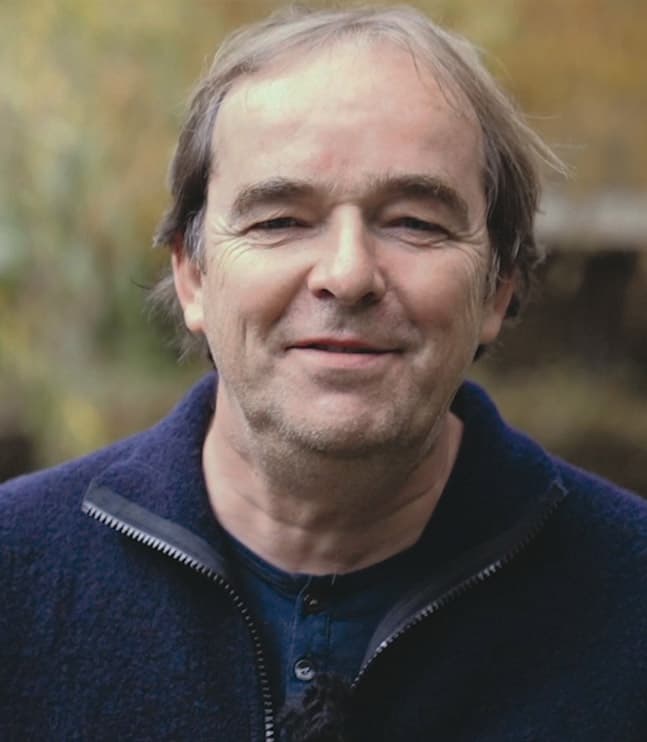Auf dem Spielfeld des Journalismus wiederum gab es jetzt in der Pandemie, aber nicht erst seitdem, eine heftige Kontroverse zwischen politischen Journalismus und Wissenschaftsjournalismus und zwar deswegen, weil eben der Journalismus generell sehr stark gepolt ist auf den Erhalt der Meinungsvielfalt, also möglichst viele Meinungen in den öffentlichen Diskurs bringen, damit die Menschen entscheiden können, welche sie für richtig halten. Und der Wissenschaftsjournalismus, so wie Sie es gerade beschrieben haben, natürlich auch versucht darüber zu informieren, was weiß die Wissenschaft. Ist schon geklärt, ob der Klimawandel jetzt eine Folge unserer Verbrennung von fossilen Energien ist oder nicht. Da gibt es einen Konflikt zwischen Meinungsvielfalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Konsens in der Wissenschaft, die etwas weiß, aber was die Menschen vielleicht noch nicht hören wollen. Das ist ja genau das Dilemma. Sie können einen Experten A neben einen Experten B setzen und B kann glaubwürdiger sein, obwohl er Unsinn redet und A kann unglaubwürdig sein, obwohl er das wiedergibt, was die Wissenschaft weiß. Das ist ja genau eines dieser Probleme, dass es so einfach ist, mit Wissenschaft im öffentlichen Diskurs in die Irre zu führen, um zum Beispiel Nichthandeln oder Verzögern von Handlungen zu ermöglichen. Das ist ja genau das Dilemma für den Journalismus.?
Ich würde das tatsächlich als Unsitte im Journalismus bezeichnen, eine falsch verstandene Ausgewogenheits-Präsentation oder -Repräsentation. Dieses Phänomen ist auch mittlerweile ganz gut erforscht: Obwohl sich alle seriösen Wissenschaftler einig sind, dass der menschengemachte Klimawandel eine große Bedrohung darstellt, gibt es irgendwelche Leute, die vielleicht auch irgendeinen akademischen Titel haben, die Interessen vertreten und das irgendwie anders sehen oder sehen wollen, vielleicht auch Geld dafür bekommen, ich weiß es nicht. Diese in einer Sendung gleichberechtigt hinzusetzen, erzeugt für den Zuhörer, für die Zuhörerin etwas Fatales, nämlich die Unmöglichkeit – genau was Sie beschreiben – zu unterscheiden, wer von beiden hat denn eigentlich mehr Gewicht. Man könnte das so eine Art Nominalillusion nennen, da ist einer dafür, einer dagegen, dann ist ja die Meinung 50:50. Hinter dieser einen Person stecken 99 Prozent aller Forscherinnen und Forscher auf diesem Erdball, alle Wissenschaftsakademien, alle Universitäten, alles was wir über diese Frage wissen, seriös wissen. Und hinter dieser anderen steht ein kleiner Lobbyverband und kein Wissen. Für den Hörer ist das aber in der Situation möglicherweise gleichbedeutend. Da ist eine Aufgabe von gutem Journalismus zu sagen: Falsche Ausgewogenheit fördert nicht Erkenntnis und sollte deswegen auch keine Rolle in falsch verstandenen Meinungsvielfalts- oder Gerechtigkeitsvorstellungen spielen, sondern man sollte wirklich die Experten zu den Fragen einladen und fertig. Dass man Leute hat, die andere Interessen haben, die sagen, ich bin Lobbyist, ich bin trotzdem gegen Klimaschutz, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, weil ich Arbeitsplätze wichtig finde oder was auch immer, das ist eine andere Sache. Bei der Frage aber, ob der Klimawandel stattfindet, gibt es de facto einfach keine zwei seriösen Meinungen, da gibt es nur eine wissenschaftliche Meinung und deswegen ist hier Meinungsvielfalt ein falsch verstandenes Gerechtigkeitsgebot.