Im Gespräch mit
Prof. Dr. Marylyn Addo
Leiterin der Sektion Infektiologie des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf UKE


sagt Prof. Dr. Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf UKE im Gespräch mit Volker Stollorz, Geschäftsführer des Science Media Center Germany.
Veröffentlicht am 8. Oktober 2020

Prof. Dr. Marylyn Addo ist Leiterin der Sektion Infektiologie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf UKE. Sie ist Ärztin und Forscherin aus Leidenschaft. Viele ihrer wissenschaftlichen Fragen ergeben sich aus der Arbeit mit Patienten, etwas, das sie motiviert und begeistert.
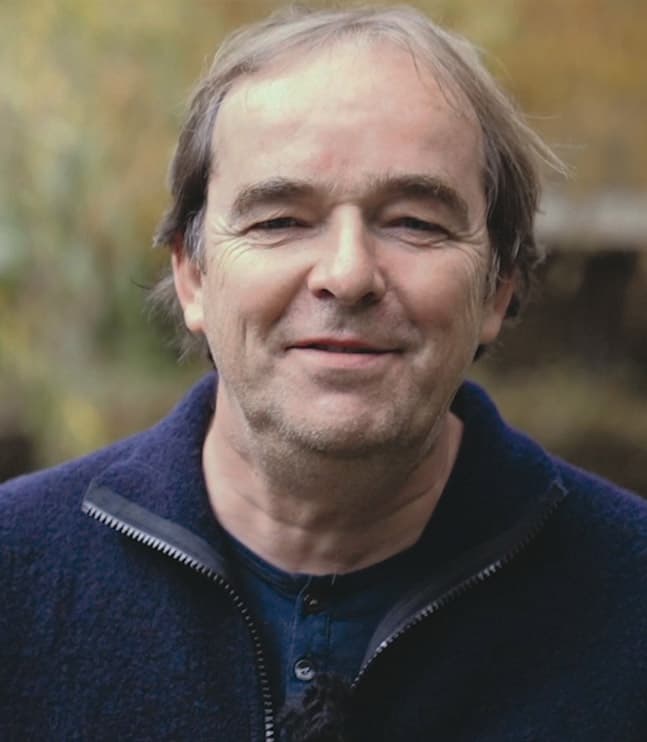
Volker Stollorz
ist Geschäftsführer des 2015 gegründeten Science Media Center Germany (SMC).
Seit 1991 berichtete der Wissenschaftsjournalist aus Leidenschaft über die
Reibungszonen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
Volker Stollorz: Was spornt Sie an? Warum forschen Sie neben Ihrer Arbeit als Medizinerin? Warum wollen Sie als Ärztin neues Wissen schaffen?
Marylyn Addo: Ich betreibe Forschung, weil ich Ärztin bin. Für mich persönlich gehen Patientenversorgung und Forschung Hand in Hand. Vom Krankenbett kommen viele meiner eigenen Forschungsfragen. Ich bin gern am Puls der Zeit, es ist immer wieder Pionierarbeit, etwas Neues in der Medizin zu erforschen. Und wenn man, wie mein Team und ich, zudem noch mit neuartigen Krankheitserregern beschäftigt ist, dann ist das sehr motivierend, morgens aufzustehen und das Gefühl zu haben, einen kleinen Beitrag leisten zu können, eine Wissenslücke zu füllen. Das Leben ist ein Riesenpuzzle und vielleicht habe ich Glück, ein kleines, passendes Stück in dieses Puzzle einzufügen. Das motiviert mich, das macht mir Spaß.
Was bedeutet für Sie der Begriff Evidenz in der Medizin?
In meinen Augen hat sich das Thema evidenzbasierte Medizin in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich besser etabliert. Ich habe in den 1990er Jahren vier Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika verbracht, damals sozusagen im Olymp der evidenzbasierten Medizin – in den Krankenhäusern der Harvard Medical School. Die Antwort auf die Frage, wie denn die aktuelle Evidenz für die Behandlung der Patienten aussieht, war fester Bestandteil der Visite. Auch in deutschen Kliniken haben wir heute Leitlinien. Es gibt Kommissionen, die sich mit der verfügbaren Evidenz beschäftigen: Was ist die beste Evidenz für jedes Krankheitsbild? In den Kommissionen sitzen ausgewiesene Experten, die sehr lange beraten und das verlässliche Wissen bewerten und dann eine Leitlinie erarbeiten. Diese dient in der Praxis als eine Orientierung für die Behandlung.
Und diesen komplexen Prozess verstehen das die Patienten?
Viele Patientinnen und Patienten haben ein gutes Verständnis dafür, was Leitlinien sind, wie sie entstehen und auf welcher Evidenz sie beruhen. Man hat natürlich selten einen Patienten, der sagt »Im New England Journal of Medicine gab es 2013 die und die Studie«. Aber bei bestimmten Erkrankungen gibt es Patienten, die sehr gut informiert sind, im Bereich HIV-Therapien zum Beispiel. Da diskutiert man als Ärztin auch schon mal: »Die Studie XYZ hat das und das gezeigt«. Oder die Patienten kommen und sagen: »Ich habe auf der letzten Konferenz gehört« oder »Ich habe die und die Studie gelesen. Was sagen Sie als Ärztin denn dazu«?
Immer mehr Wissen der Wissenschaft ist weltweit verfügbar: Stichwort Google Universität. Wie gehen Sie damit um? Welche Technik wenden Sie an, Menschen davon zu überzeugen, dass vielleicht ihre Meinung, die die sich gebildet haben, doch noch nicht ganz diejenige ist, die von den Leitlinien oder der evidenzbasierten Medizin für die richtige gehalten wird?
Da muss man den Dialog suchen. Es funktioniert ein bisschen wie bei einer Gegendarstellung.
Man ordnet Datenpunkte oder einen klinischen Datensatz, den Patientinnen oder
Patienten mitbringen, in den Kontext ein und diskutiert dann offen und ehrlich
mit ihnen darüber, warum diese Schlussfolgerung nicht richtig oder anders interpretiert
werden kann. In der Medizin ist es mit »richtig oder falsch« ja so eine Sache.
Die meisten Probleme besitzen erhebliche Komplexität. Denn manche Studien zeigen
zwar etwa die Wirkung XYZ, aber dann heißt es, diese Studien auch kritisch zu
beleuchten: Welche Patienten waren das genau? Welche Vorerkrankungen hatten die Patienten?
Gab es eine Kontrollgruppe?
Das Peer-Review-Verfahren ist ja ein wesentlicher Bestandteil wissenschaftlicher
Publikationen, in dem unabhängige Wissenschaftler die Studie lesen und auf Plausibilität
prüfen. Wenn Artikel oder Studien durch die neuen Preprint-Server veröffentlicht
werden, erfolgte das Peer-Review noch nicht. Auch wenn es in der Welt der Wissenschaft
ein ganz normales und sinnvolles Vorgehen ist, besteht hier möglicherweise die
Gefahr, dass sich diese ungeprüften Informationen verbreiten oder so ausgelegt
werden, wie es die jeweilige Fragestellung gerade hergibt. Für mich als Ärztin
heißt das, ich trete in einen Dialog ein und ich verweise auf evidenzbasierte
Leitlinien, die von renommierten und ausgewiesenen Forschenden erstellt werden.
Zudem gibt es meist nicht nur eine, sondern viele Evidenzen, das kann ich im
Gespräch meist gut erklären. Aber natürlich gibt es am Ende immer noch Leute,
die sagen, ich will diese Therapie nicht, aber das ist ja in der Tat ein ganz
individuelles Recht.
Wir haben in dieser Pandemie echte epistemische Unsicherheit kennengelernt. Was haben Sie dabei gelernt in der Kommunikation?
Es ist permanentes Lernen, immer noch. In der Zeit, die ich überschauen kann, hatten wir noch nie eine so hohe mediale Präsenz von wissenschaftlichen Themen und die ganze Gesellschaft hing quasi an den Lippen von Virologen, Infektiologen, Soziologen und Epidemiologen. Dazu kommt noch: die neue Art der Medienberichterstattung, die neuen Formate in einer solchen Situation. 2014, damals, als Ebola auftauchte, waren soziale Medien wie etwa TikTok, Instagram & Co noch nicht so präsent. Entweder habe ich das damals nicht so wahrgenommen oder es war nicht so extrem relevant, weil es gesellschaftlich noch nicht breit angekommen war. Diese Informationsflut zu bündeln, die verschiedenen Medienformate – ich glaube, das war zu Beginn eine große Herausforderung für Wissenschaft und Medizin, da an den richtigen Stellen die richtigen Botschaften zu senden. Aber ich finde auch, dass inzwischen sehr gut nachgesteuert wurde.
Welche Erfahrung haben Sie persönlich gemacht?
Ich habe zum Beispiel auf diesem Gebiet etwas zum ersten Mal gemacht und fand es toll: Zu Beginn der Pandemie wurden die Top Ten Falschinformationen über das neuartige Corona-Virus hinterfragt. Dann kam jemand auf die Station, und das war nicht ein Kamerateam mit fünf Leuten, sondern das war ein junger Mitarbeiter mit seinem Smartphone und einem kleinen Mikro. Ich durfte dann kurz und knackig die Fehlinformationen aufklären, das wurde dann in verschieden Social Media online gestellt. Das hatte dann, insbesondere für eine jüngere Zielgruppe, eine viel höhere Reichweite gehabt als etwa ein klassisches Interview. Dass wir diese Power der sozialen Netzwerke nicht unterschätzen dürfen, fand ich schon beeindruckend. Und dann müssen wir einen anderen Umgang finden mit Wissenschaftsjournalismus, denn es wird nicht unsere letzte Pandemie sein.

Welche Erfahrung haben Sie mit dem Wissenschaftsjournalismus gemacht, sehen Sie da Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Akteuren, denen Sie begegnen? Ist das für Sie etwas anderes, mit einem allgemeinen politischen Journalisten zu sprechen oder mit einem Wissenschaftsjournalisten?
Ja, hier gibt es tatsächlich große Unterschiede. Es gibt Wissenschaftsjournalisten, die haben ein Grundverständnis, oft auch mit dem Hintergrund eines naturwissenschaftlichen Studiums, die haben sehr intensiv recherchiert, sie haben mit vielen Forschenden gesprochen. Das ist ein ganz anderes, fachlicheres Gespräch miteinander. Ich habe aber auch schon mit vielen fachfremden Journalisten gearbeitet, da ist das Gespräch ein ganz anderes, da steigt man allgemeiner ein, muss komplexe Sachverhalte verkürzt darstellen. Der Blickwinkel, die Motivation, das Ziel ist da einfach oft anders. Wissenschaftsjournalisten haben, das ist mein Eindruck, ein genuines Bedürfnis, aufzuklären und Fakten zu schaffen und Fake News entgegen zu treten. Tagesaktuelle Medien suchen Schlagzeilen, da muss es etwas Knackiges sein. Da kann es auch mal vorkommen, dass Zitate in einen anderen Kontext gesetzt werden, wo man dann als Interviewter sagen muss: In diesem Kontext können Sie das so nicht schreiben oder dieser Halbsatz funktioniert als Überschrift nicht.
Was würde Ihrer Meinung nach passieren, wenn durch anhaltende Finanzierungsprobleme im Digitalen Wissenschaftsjournalismus einfach aussterben würde als Profession? Was passierte dann im öffentlichen Diskurs?
Also das wäre für Forschende sehr schwierig. Ich hoffe, dass es nicht passiert und wenn, dass andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. Vielleicht könnte die Deutsche Forschungsgemeinschaft unabhängige Recherchen ausschreiben. Wenn es wirklich passierte, müssten wir in der Wissenschaft entgegensteuern. Wir müssten unsere Wissenschaftler mehr schulen. Wissenschaftskommunikation ist etwas, was in der Ausbildung im Studium zu kurz kommt. Ich glaube, das könnte zumindest ein optionales Modul sein. Vielleicht gibt es künftig schöne Karriereoptionen, wenn es denn Finanzierungen für Journalismus über Wissenschaft im Digitalen gibt. Ich habe auch viele Wissenschaftsjournalisten kennengelernt, die das angefangen haben nach dem Studium, die ich zuvor noch im Labor gesehen hatte und die sich dann halt in diese Richtung orientiert haben. Mein Vorschlag wäre, dass man Wissenschaftler mehr mitnimmt und auch früh im Studium schult, dass man junge Forscher für Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus sensibilisiert als wichtige Dinge. Es braucht nicht jeder ein Medientraining, aber es braucht eine Sensibilisierung. Es wird noch zu stark auf bloße Kommunikation der Inhalte fokussiert und dass man sie transportieren muss. Aber das Wie ist entscheidend. In Amerika musste man als Forschende oft “Elevator Talks” vorbereiten für ein nichtwissenschaftliches Publikum, etwa warum ist meine Forschung wichtig, das reflektiert man dann ganz anders. Insgesamt haben wir in der Wissenschaftskommunikation noch viel Luft nach oben.
Gibt es eine Frage, die Sie sich von Journalisten immer gewünscht hätten, aber noch nie gestellt wurde? Was hätten Sie gerne einmal gesagt, was aber nicht gefragt wurde?
Nein, ich finde, meine Argumente und Anliegen werden gehört.
Wir haben in der Initiative das schillernde Wort »Together for Fact News« gewählt, das mit den Worten Fake News, Fact News spielt. Was assoziieren Sie, wenn Sie hören: »Together for Fact News«?
Ich sehe das als einen gemeinsamen Auftrag, »Together« als Gesellschaft gegen Fake News und Desinformation vorzugehen. Wenn wir uns diese Gegen-Corona-Demonstrationen anschauen, dann sehen wir, wie viele politischen Strömungen dort mitsurfen. Da sind ja durchaus auch demokratiefeindliche Bewegungen dabei und deswegen sehe ich das als Auftrag, den wir nur alle in der Gesellschaft gemeinsam umsetzen können. »Together for Fact News« ist insofern ein ganz wichtiger Auftrag. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass wir dieses Thema haben, aber in der Pandemie ist jetzt akut lebenswichtig geworden. Wir hatten ja auch schon die Bewegung »Science statt Silence«, das ist für mich eine Weiterentwicklung. Jetzt reden wir über eine Pandemie, damals ging es um das Thema Klimaschutz. Für mich ist es ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir nur gemeinsam bewältigen können.
Erleben Sie es als Risiko, wenn man sich bewusst zeigt und heraustritt und für verlässliches Wissen eintritt? Ich erlebe als Journalist, dass man das, was man weiß, auch öffentlich vertreten kann und muss. Das ist unser Job, da sind sich Wissenschaft und Journalismus ähnlich, dass man eben das, was man weiß, auch kommuniziert und den Gegenwind aushält. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Das sehe ich auch so. Ich beschäftige mich ja auch mit einem kniffligen Thema. Das Impfen von Gesunden ist eines der sensibelsten Themen überhaupt, weil es total viele Emotionen schürt. Ich persönlich bin leidenschaftlich davon überzeugt und Fakt ist, dass es außer sauberem Wasser in der Welt, keine öffentliche Gesundheitsintervention gibt, die mehr Leben gerettet hat. Deshalb ist das Thema Impfen eines, das mir sehr am Herzen liegt. Zwar habe ich bisher noch wenig persönlichen Angriffe erlebt, aber natürlich gibt es leider auch negative Erfahrungen. Hinzu kommt, ich bin female und dunkelhäutig und da bekommt man ja noch ganz andere Rückmeldungen. Aber im Grunde ist das wie in anderen politischen Themen auch: Man muss für die Sachen, die einem wichtig sind, gerade stehen und das beinhaltet zum Teil auch kalkulierte Risiken. Kommunizierende Forschende und Journalisten brauchen deshalb auch Schutzräume.
Welche Ideen haben Sie als Wissenschaftlerin oder auch als Medizinerin, was man am Journalismus über Wissenschaft noch verbessern könnte? Sehen Sie auch aus Ihrer Sicht Defizite, wie würden Sie sich den Wissenschaftsjournalismus der Zukunft wünschen?
Mein Eindruck ist, dass es eigentlich sehr gut läuft, dass sich auch der Wissenschaftsjournalismus verschiedene Formate, die erfolgreich sind, zunutze macht, ich meine zum Beispiel Podcasts, Youtube-Channels. Es sind ja auch interessante Persönlichkeiten dazu gekommen, die in einer neuen Art und Weise ihr Publikum erreichen von Jung bis Alt. Ich bekomme das von der Familie oder von Freunden widergespiegelt: Viele kennen zum Beispiel Mai Thi Nguyen-Kim oder Podcasts, die gut angekommen sind. Ich finde, da hat sich ganz viel getan und es gibt viele informative Formate.

Was fehlt?
Es gibt viele guten Perlen des Wissenschaftsjournalismus – es ist aber in der Tat manchmal schwer, diese in dieser unglaublichen Informationsflut zu finden. Sie sind ja da und das ist wunderbar, aber zugleich gibt es eine nicht zu kontrollierende Menge an mehr oder weniger seriösen Informationen. Ich selbst bin zum Beispiel wenig in Social Media unterwegs, dafür finde ich einfach keine Zeit. Einen Podcast kann ich mir auch nur anhören, wenn ich mal von Hamburg nach Köln fahre. Ich bin oft gefragt worden: Herr Drosten hat im Podcast XYZ gesagt, da bin ich dann dankbar, dass das Hörerlebnis auch transkribiert wird für Schnellleserinnen. Ich habe eine Kollegin, die ist »Emerging Diseases« Professorin in den Niederlanden, sie hat die Verbreitung von Desinformation wissenschaftlich untersucht. Wenn da ein bestimmtes Schlagwort eingegeben wurde, dann waren von den ersten zehn Hits acht Verschwörungstheorien und erst dann kamen die Links der WHO und anderer verlässlicher Quellen. Wir müssen es irgendwie schaffen, auch mit Wissenschaftsjournalismus, dass die Quellen, wo wichtige und richtige Informationen zu finden sind, priorisiert werden. Das ist eine große Herausforderung für uns. Es gibt so viele Informationen, die zu bündeln sind.
Das ist eine Herausforderung für den Wissenschaftsjournalismus der Zukunft. Wie kann ich künftig Berichte recherchieren? Wie kann ich Menschen interessieren für das, was wichtig und richtig ist? Das ist eine riesige Aufgabe. Ich finde, es ist eine gemeinsame Aufgabe von Wissenschaft und Journalismus, weil sie beide eigentlich nach Wahrheit oder Wahrhaftigkeit streben. Das ist die DNA ihrer Profession ...
Auch Journalismus hat sich verändert. Wie wichtig guter Journalismus und vor allem Wissenschaftsjournalismus ist, hat uns die Pandemie sehr eindeutig gezeigt. Ich glaube, hier sollten beide Seiten – also Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus – überlegen, wie sie sich noch besser aufstellen können.
PDF zum Download (2,4 MB)